Bienvenus - Bine aţi venit - Benvenuti Bienvenidos - Benvinguts - Bemvindos
Die Romanische Philologie beschreibt einen wesentlichen Teil der europäischen Mehrsprachigkeitslandschaft: die Welt der romanischen Sprachen.
Die
didaktische Mehrsprachigkeitsfor-schung zielt auf die Optimierung des
Erlernens von Fremdsprachen und die Entwicklung der sprachenteiligen
Gesellschaft. Dass nun Französisch, Italienisch, Portugiesisch oder Spanisch in
Deutschland vor allem als zweite oder dritte Fremdsprache erlernt werden,
erklärt das Interesse der romanistischen Mehrsprachigkeitsdidaktik am Bereich
der Tertiärsprachen. Dem inferentiellen Lern-begriff folgend, erforscht
sie mit empirischen Methoden die Interaktion der sprachlichen und kulturellen
Vorkenntnisse mit neuen Lerninhalten sowie deren Einformung in das deklarative
und prozedurale Sprachenwissen. Durch die Analyse der beim Lernen greifenden
mentalen Prozesse beschreibt sie den Erwerb einer nachgelernten Fremdsprache und
deren Rückwirkung auf schon verfügbare Sprach-bestände. Das betrifft nicht allein
sprachliche Zusammenhänge, sondern ebenso das Ver-halten von Lernenden in
bestimmten Lern-situationen und Lernarrangements. Zur ihrer grundlegenden
Forschung zählt daher die Untersuchung von außen- und selbst-gesteuerten
fremdsprachlichen Erwerbspro-zessen nach der Formel
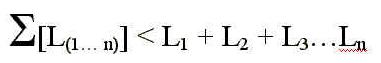 wobei Sigma das gesamte
Sprachenwissen eines Individuums bezeichnet. Die didaktische
Mehrsprachigkeitsforschung hat es sowohl mit sprachlichen Oberflächen (lingualen Transferbasen) zu tun als
auch mit ihrer mentalen Verarbeitung sowie den Strategien und Techniken der
Lernsteuerung. Denn auch im Bereich der Lernerfahrungen sind
(lern)ökonomische Effekte aus dem Erlernen unterschiedlicher Zielsprachen
erreichbar. Nach den Ergebnissen mehrerer mehrsprachigkeits-didaktischer Analysen
führt der interlinguale Transfer nicht nur zum Wachstum von deklarativem
und prozeduralem Wissen in einer nachgelernten Sprache sowie zur Stabilisierung
von vorgelernten Sprachbeständen. Er generiert auch didaktische Kenntnisse, die
aus der Zusammenführung des Wissens aus unterschiedlichen Sprachen und der
an-hängigen Lernerfahrungen entstehen.
wobei Sigma das gesamte
Sprachenwissen eines Individuums bezeichnet. Die didaktische
Mehrsprachigkeitsforschung hat es sowohl mit sprachlichen Oberflächen (lingualen Transferbasen) zu tun als
auch mit ihrer mentalen Verarbeitung sowie den Strategien und Techniken der
Lernsteuerung. Denn auch im Bereich der Lernerfahrungen sind
(lern)ökonomische Effekte aus dem Erlernen unterschiedlicher Zielsprachen
erreichbar. Nach den Ergebnissen mehrerer mehrsprachigkeits-didaktischer Analysen
führt der interlinguale Transfer nicht nur zum Wachstum von deklarativem
und prozeduralem Wissen in einer nachgelernten Sprache sowie zur Stabilisierung
von vorgelernten Sprachbeständen. Er generiert auch didaktische Kenntnisse, die
aus der Zusammenführung des Wissens aus unterschiedlichen Sprachen und der
an-hängigen Lernerfahrungen entstehen.
Dies erscheint umso
wichtiger, als im schulischen Rahmen die Dauer des Sprachenunterrichts begrenzt
ist und nicht-sprachliche Fächer zunehmend in einer anderen als der
Muttersprache der Schüler oder der Sprache der Schule unterrichtet werden
(bilingualer Sachfachunterricht).
Das Vergleichen von
unterschiedlichen lingualen Oberflächen und ihrer mentalen Interaktion bei
Lernenden erzeugt nicht nur deren Sensibilisierung für eine einzelne Sprache.
Indem Lernende entsprechende Elemente und Funktionen der Sprache 'Lx' mit denen
von 'Lx+1' oder 'Lx+3' deklarativ und/oder prozedural vergleichen, konstruieren
sie explizit und/oder implizit ein Sprachenwissen, das sich aus den Strukturen
der mental miteinander verbundenen Sprachen speist. Es handelt sich in der Tat
um interlinguistisches Wissen.

Was nun die Regularitäten
der (neuen) Zielsprache betrifft, so entdecken sie diese vermittels des
Aufstellens und Überprüfens von Hypothesen. Dabei greifen sie auf sich anbietende
Transferbasen aus den aktivierten Sprachen zurück. Auf diesem Wege bauen die
Lernenden eine Spontan- oder Hypothesen-grammatik auf. Wie beim
Erstsprachenerwerb ist diese systematisch und doch hochgradig
dynamisch, ja ephemer, denn sie modifiziert sich mit jeder sprachlichen
Handlung, die das Individuum erfolgreich rezeptiv oder aktiv
vollzieht.
Dank der vollzogenen
interlingualen Transfer-prozesse entdecken die Lernenden ein Intersystem, welches ihr Wissen aus
verschiedenen Sprachen miteinander vernetzt und zwischensprachliche
Korrespondenz-regeln (positive wie negative Transferbasen) ausbildet. Wird in
diesem Stadium Bewusstheit ausgebildet, so handelt es sich um Mehrsprachenbewusstheit (multi-language awareness). Während sich
nun die Spontangrammatik immer wieder neu aufbauen muss, speichert das
Intersystem die positiven und negativen Transfererfahrungen langfristig. Im
Gegensatz zur Spontangrammatik ist es daher vergleichsweise
stabil.
Parallel zum Wachstum der
einzelsprachlichen und zwischensprachlichen Wissensspeicher vergrößert sich aber
auch das Wissen über das Lernen selbst (learning awareness), soweit die
Lernerfahrung Teil der beobachtenden Bewusstseinsbildung wird. Dies
unterstreicht die Bedeutung der Lernsteuerung. Da dieses Wissen am
Gegenstand der Interaktion zwischen Sprachen gewonnen wird, könnte man in
Erweiterung von Mario Wandruszkas Begriff der Interlinguistik auch von einer Interdidaktik sprechen. Welch ein
Desiderat interdidaktische Forschung aus der Sicht von Lernenden darstellt,
zeigt sich zum Beispiel daran, dass die bis heute gängige einzelsprachliche
didaktische Grammatiko-graphie schon aufgrund terminologischer Mehrdeutigkeiten
und fehlender didaktisch wirksamer sprachvergleichender Darstellungen den
Lernenden keine optimalen Hilfen an die Hand gibt.